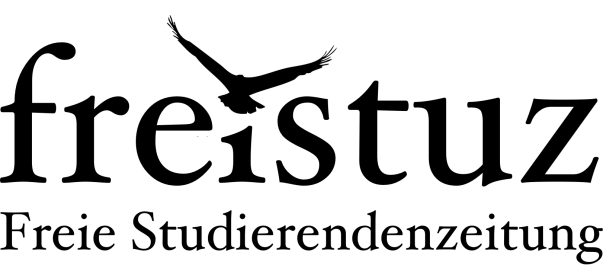Martin Horn hat bereits bei Greenpeace in Neuseeland gearbeitet, als Dozent in Ludwigsburg und als Europa- und Entwicklungskoordinator im Sindelfinger Rathaus. Seit Anfang Juli ist er als Freiburger Oberbürgermeister im Amt. Die freistuz hat sich wenige davor Tage mit dem Wahlsieger getroffen.
Dreimal mussten die Horns schon umziehen, seit sie in Freiburg sind. Von Zwischenmiete zu Zwischenmiete. Zwischenzeitlich waren sie zum Ausweichen nach Gundelfingen gezwungen. Erst seit er plötzlich in der ganzen Stadt bekannt ist, wurden Martin Horn und seiner Familie plötzlich zahlreiche Wohnungen angeboten. „Wohnraum ist einfach unverschämt teuer!“, stellt er fest. Er kann inzwischen also selbst ein Lied singen von dem Thema, das den Oberbürgermeisterwahlkampf am stärksten prägte. Natürlich hatte er es auch selbst auf der Agenda. „Klar ist, dass Wohnraum deutlich mehr politisches Gewicht bekommen wird“, kündigt er schonmal an.
 Einen vollen Terminkalender hat der neue Freiburger Oberbürgermeister schon vor dem Amtsantritt. Trotzdem nimmt er sich – zwischen Baden FM und dem Sportclub Freiburg – Zeit für das Gespräch mit der Studierendenzeitung. Gut, nicht so viel Zeit, wie eigentlich geplant. Fast eine halbe Stunde zu spät parken Martin Horn und seine persönliche Referentin Frau Horstkötter vorm Café in Littenweiler, entschuldigen sich mehrfach, das Interview beim Lokalradio habe sich leider in die Länge gezogen. Frau Horstkötter holt Getränke, während Horn freudig von einem Mann am Nachbartisch begrüßt wird, dann kann es losgehen. Noch vor einigen Monaten kannte ihn kaum jemand in der Stadt. Der 33-jährige Verwaltungsmitarbeiter aus Sindelfingen war im Wahlkampf das große Fragezeichen unter den sechs Bewerbern. Ein Newcomer, der keiner Partei angehörte und in Freiburg noch nicht einmal eine Wohnung hatte. Es ist nicht leicht, sich da zu profilieren, zumal er der Konkurrenz eine Menge Angriffsfläche bot. Kritikpunkt Nummer eins: Martin Horn sei ein Karrierist, der mit Ausschreibung der OB-Stelle plötzlich sein Interesse an den Sorgen und Nöten der Freiburger entdeckt habe.
Einen vollen Terminkalender hat der neue Freiburger Oberbürgermeister schon vor dem Amtsantritt. Trotzdem nimmt er sich – zwischen Baden FM und dem Sportclub Freiburg – Zeit für das Gespräch mit der Studierendenzeitung. Gut, nicht so viel Zeit, wie eigentlich geplant. Fast eine halbe Stunde zu spät parken Martin Horn und seine persönliche Referentin Frau Horstkötter vorm Café in Littenweiler, entschuldigen sich mehrfach, das Interview beim Lokalradio habe sich leider in die Länge gezogen. Frau Horstkötter holt Getränke, während Horn freudig von einem Mann am Nachbartisch begrüßt wird, dann kann es losgehen. Noch vor einigen Monaten kannte ihn kaum jemand in der Stadt. Der 33-jährige Verwaltungsmitarbeiter aus Sindelfingen war im Wahlkampf das große Fragezeichen unter den sechs Bewerbern. Ein Newcomer, der keiner Partei angehörte und in Freiburg noch nicht einmal eine Wohnung hatte. Es ist nicht leicht, sich da zu profilieren, zumal er der Konkurrenz eine Menge Angriffsfläche bot. Kritikpunkt Nummer eins: Martin Horn sei ein Karrierist, der mit Ausschreibung der OB-Stelle plötzlich sein Interesse an den Sorgen und Nöten der Freiburger entdeckt habe.
Falsch, entgegnet Horn. Dass seine Zukunft in Freiburg liege, habe schon länger festgestanden, schon seit langem habe er Freunde und Familie hier; die Stadt passe einfach vom Lebensgefühl her. Spätestens im Sommer 2017 hätten seine Frau und er beschlossen, dass ihre Zukunft in Freiburg liegt. Das habe er im Wahlkampf jedoch bewusst nicht geäußert. Da er sich nach Möglichkeiten umgesehen habe, weiterhin im politischen Bereich zu arbeiten, bot sich anstehende OB-Wahl einfach gut an: „Da hat sich dann ein Stein an den anderen gefügt“, sagt Horn.
„Die Frage nach dem Parteieinttritt hat sich irgendwann gar nicht mehr gestellt.“
Hört man ihn so reden, dann wirkt es fast, als sei der – für den Großteil der Medien sehr unerwartete – Wahlsieg für ihn selbst eine sichere Sache gewesen. War er denn gar nicht überrascht? „Es wäre vermessen zu sagen, dass ich nicht überrascht war über die Deutlichkeit des Wahlergebnisses“, entgegnet er, „aber ich wäre nicht angetreten, wenn mir nicht mein Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis das Gefühl vermittelt hätte, dass die Stadt sich nach Veränderung sehnt.“
Das Gespräch ist noch keine fünf Minuten alt, da fällt zum ersten Mal das Wort, das man Martin Horn in den letzten Monaten gefühlt am häufigsten hat sagen hören: „Wechselstimmung“. Diese Stimmung, die der designierte OB schon in allen Teilen Freiburgs vernahm, als sie noch niemand anders bemerkte, spülte ihn letztendlich ins Amt. Bei unzähligen Bürgersprächen sei sie ihm entgegengeschlagen. Die Leute dort hätten sich unzufrieden mit Salomons Politikstil gezeigt, wollten ihm diesmal nicht wieder ihre Stimme geben. „Waaahnsinnig Vielen“ sei es so gegangen – mit langem „a“! Auch das Wort „Arroganz“ sei oft gefallen. Lag es an dieser Unzufriedenheit, dass die Aufmerksamkeit für den Wahlkampf so unerwartet hoch war? Dass manche Kandidatenduelle hemmungslos überfüllt waren mit jungen Leuten? Vielleicht, aber mit Sicherheit trugen auch die sozialen Medien zu dem hohen Interesse bei, das weiß auch Martin Horn. „Ich glaube, wenn der Wahlkampf nur auf Wahlplakaten und im Lokalteil der Badischen Zeitung stattgefunden hätte, wären da nicht so viele gekommen“, bekennt er. Das rege Interesse deutet er als gute Grundlage für das, was er versprochen hat: Ein neuer Politikstil solle her. „Gemeinsam gestalten, statt einsam verwalten“, hieß das im Wahlkampf.
Viele Beobachter konnten sich währenddessen nicht recht entscheiden, ob Horns Parteilosigkeit nun für oder doch eher gegen seine Glaubwürdigkeit spricht. Dafür, sagten seine Unterstützer, da er nicht den Zwängen eines Parteiapparats unterworfen sei. Dagegen, meinten etwa politische Gegner, da Horn seine eindeutige Nähe zur SPD ebenso zu kaschieren versuchte wie umgekehrt die SPD ihre zu ihm. Hört man ihm zu, kommt einem Horns Argumentation eigentlich ganz plausibel vor: Als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung sei er schon immer nah an der SPD gewesen, inhaltlich verbinde ihn, der einst bei Greenpeace in Neuseeland arbeitete, aber auch vieles mit den Grünen. Außerdem war er bei den Liberalen im EU-Parlament beschäftigt sowie als Europa- und Entwicklungskoordinator unter einem CDU-Bürgermeister. „Die Frage nach dem Parteieintritt hat sich irgendwann gar nicht mehr gestellt“, so Horn. In der Kommunalpolitik gehe es sowieso nicht um feste Koalitionen, sondern um Sachfragen. Vielleicht entpuppt sich das Fehlen eines Parteibuchs also doch als Vorteil.
Andererseits liegen seine Kritiker nicht ganz falsch: Die SPD setzte im Wahlkampf strategisch auf einen parteilosen Kandidaten. Horn selbst spekulierte gegenüber der „Zeit“ nach dem Wahlsieg, er hätte als offizieller SPD-Kandidat wegen des angekratzten Images der Bundespartei wohl 10 Prozent weniger geholt. Stattdessen bekam er mit Nivea-blauen statt SPD-roten Plakaten 44,2 Prozent der Wählerstimmen.
I bims, der Martin
Geschafft hat er das nicht zuletzt durch eine groß angelegte Werbekampagne, ungewohnt groß für kommunalpolitische Dimensionen. Kein anderer Kandidat zeigte sich so nahbar. Horn sprach oft selbst vor der Mensa Studenten an oder lud Interessierte auf ein Bier ein. Vor dem zweiten Wahlgang ließ er auf dem Platz der alten Synagoge ein „mobiles Wohnzimmer“ aufbauen. Auch hier war er vor Ort, stand zehn Stunden lang für Gespräche bereit. Hinzu kamen Begegnungen mit Bürgervereinen, Haustürbesuche, Podiumsdiskussionen, Besuche auf Wochenmärkten und noch einiges mehr. Jeder Terminkalender würde da an seine Grenzen stoßen.
Vor allem aber nutzte Martin Horn wie kein anderer Kandidat die sozialen Medien für den Wahlkampf. Nahezu jeder Termin wurde auf Facebook, Twitter oder Instagram dokumentiert – und inszeniert. Auf stylishen Fotos konnte man einen lächelnden Martin Horn sehen, der sich bei strahlendem Sonnenschein mit anderen lächelnden Menschen trifft. Auf der einen Seite sehen diese Bilder nicht viel anders aus als die Fotos anderer Politiker, die gerade Wahlkampf machen. Auf der anderen muss man in diesem Format fast unweigerlich an moderne Influencer denken. Überhaupt hatte Horns Wahlkampf etwas betont jugendliches. Kein Kandidat konzentrierte sich so sehr auf Termine rund um die Uni, bei denen der 33-jährige locker als Kommilitone durchging. Die „Verjüngung der Politik“ diente als einer seiner zentralen Slogans. Neben größerer Beteiligung junger Leute betonte Horn immer wieder Themen wie Digitalisierung, Ausgehkultur oder Förderung der Start-Up-Szene. Der Fokus auf die junge Zielgruppe ging so weit, dass auf einer vor der Mensa verteilten Postkarte der Satz: „I bims, der Martin“ prangte.
Man konnte das auch als Anbiederung empfinden. Nicht wenige warfen dem Kandidaten vor, sein junges Alter ausspielend einen hippen Wohlfühlwahlkampf für Studenten zu führen – ohne konkrete Inhalte anzubieten. Der Wahlsieger kann diese Kritik nicht nachvollziehen. „Wer das sagt, der war nie auf einer Veranstaltung von mir“, entgegnet er. Und weiter: „ich glaube, ich habe mit der Qualität meiner Antworten überzeugt. Nicht mit Social-Media-Fotos und nicht mit Wohlfühlatmosphäre.“ Formate wie „Ein Bier mit Martin Horn“ wären demnach niemals so erfolgreich gewesen, wenn er in den Gesprächen nicht inhaltlich überzeugt hätte. Kurz überlegt er, dann fügt er fast entschuldigend hinzu: „Aber Social Media und gute Fotos haben natürlich einen Teil dazu beigetragen.“
Ein Effekt der Omnipräsenz wird während des Interviews deutlich: Man fühlt sich, als würde man dem jungen Mann mit der Brille und dem Jackett nicht zum ersten Mal gegenübersitzen. Eher so, als hätte man sich schon mehrfach mit ihm bei einer Bio-Limonade über Digitalisierung und bezahlbaren Wohnraum unterhalten. Es ist, als hätten die sozialen Medien einen persönlich mit Martin Horn bekannt gemacht. Den Vorteil will er auch als amtierender OB nutzen. Von den drei Mitarbeitern, die er zum Zeitpunkt des Interviews bereits eingestellt hatte, hat eine die Aufgabe, „diese Kanäle“ weiter zu pflegen. Er verstehe das aber nicht nur als Möglichkeit zur Selbstdarstellung, erklärt Horn: „Es geht nicht darum, zu zeigen: ‚Oh, wie cool und wie toll ist dieser Martin Horn!‘, sondern wir versuchen bewusst, Menschen zu erreichen, die nicht mehr den Kommunalteil der Tageszeitung lesen“. Kommunalpolitik sei leider „extrem unsexy“ und gerade für junge Leute oft sehr weit weg. „Wir sind die jüngste Stadt Deutschlands und das spiegelt sich Null im politischen Kontext wieder“, erläutert Horn. Immer wieder sagt er diesen Satz im Gespräch, in verschiedenen Variationen. Nun planen er und sein Team Livesprechstunden auf Facebook und Instagram innerhalb der ersten 100 Tage seiner Amtszeit. „Ungefiltert und gnadenlos kann man mir da Sachen an den Kopf werfen“, verspricht er.
„Ich werde Menschen enttäuschen.“
Man merkt Martin Horn die Vorfreude auf seine kommenden Aufgaben an. Er habe großen Respekt vor dem Amt und der Verantwortung. „Auch wenn ich eine lockere Art habe, heißt das nicht, dass ich das auf die leichte Schulter nehme. Ich hab‘ noch nie ‘nen Gemeinderat geleitet, ich hab‘ noch nie ‘nen Haushalt eingebracht. Das ist für mich alles das erste Mal, aber ich hätte nicht kandidiert, wenn ich nicht Lust drauf hätte.“
Die letzten Minuten des Interviews finden beim gemeinsamen Fußweg zum Schwarzwald-Stadion statt, wo Horn der nächste Termin erwartet. „Schön erstmal 25 Minuten sitzen gelassen und dann auch noch zum Spaziergang genötigt. So haben sie‘s gerne!“, scherzt er. Fragt man ihn nach seinen konkreten Plänen, redet Martin Horn viel und schnell. Grob umreißt er die Ziele, die er in den ersten 100 Tagen anpacken will, erläutert vor allem nochmal seine Vorhaben für junge Leute. Er wolle mit Jugendclubs wie dem Artik kooperieren, neue Proberäume, kulturelle Räume und Orte zum Feiern schaffen. Außerdem wünsche er sich ein Studententicket, das im ganzen Bundesland gelte, auch wenn er darauf nur begrenzten Einfluss habe. Mehrmals unterbricht er sich selbst, sagt: „Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate!“. Schließlich wolle er nicht seine bevorstehende Amtsantrittsrede vorwegnehmen.
Was das bezahlbare Wohnen angeht, dämpft er die Erwartungen ein wenig: „Das ist das Thema, das am meisten Zeit brauchen wird. Da werde ich Menschen enttäuschen. Die Studis, die heute ein WG-Zimmer suchen, profitieren nicht von Wohnbauprojekten, die erst in fünf bis zehn Jahren anfangen zu wirken. Aber trotzdem müssen heute diese Weichen gestellt werden“. Fehlenden Realitätssinn kann man ihm jedenfalls nicht vorwerfen.