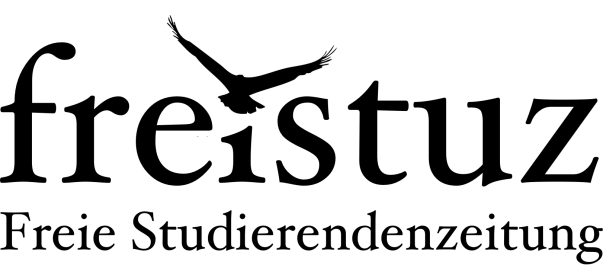Der neue Film des kontroversen Regisseurs ist eine Geschichte des Scheiterns. Es ist ironisch, dass von Trier versagt eine sinnige und intelligente Geschichte zu inszenieren. Eine Filmkritik über einen der meistdiskutiertesten Streifen von Cannes.
In „The House that Jack built” wird in 5 kurzen und beliebigen Episoden aus dem Leben des Protagonisten erzählt. Jede Episode ist eine kurze, meist absurde Mordgeschichte des Serienkillers, in der äußerst brutal unschuldige und zufällig ausgewählte Zivilisten Jacks narzisstisch motivierten Gewaltausbrüchen zum Opfer fallen. Er erschießt, erwürgt und erschlägt auf FSK 18-würdiger Art und Weise Kinder, Männer und Frauen, gewissenlos und ohne Angst. Es ist ein altbekanntes Konzept: Der Mörder, der nichts außer dem Allerbösesten verkörpert, wird zum Protagonisten verkehrt und die Zuschauerschaft darf sich an seinen Schandtaten ergötzen und entwickelt im moralischen Zwiespalt am Ende des Films doch Empathie für den offensichtlich Bösen. Das kann wie in Mary Harrons Meisterwerk „American Psycho“ wunderbar funktionieren, wie in „Suicide Squad“ einfach nur peinlich werden, oder aber wie in „Bad Boys“ die moralischen Grenzen nicht nur strapazieren, sondern auch deutlich überschreiten.
Lars von Trier schafft es alle drei Eigenschaften zu vereinen. Teilweise sieht man einen ambivalenten, von Neurosen geplagten, einsamen Mann, der nicht nur Täter ist, sondern auch Opfer seiner selbst. Doch am meisten bleibt das Ausnutzen altbekannter Klischees hängen. Der Film bietet inhaltlich kaum etwas Neues, eine innovative Story findet man ebenso wenig wie eine scharfe Charakterzeichnung des Mörders.
„The House that Jack built“ wollte von einem Mörder erzählen und seine Motive autopsieren. Jedoch ist seine Motivation älter und verbrauchter als von Triers klassische Schnitt- und Kameratechnik, welche in seinen unbestritten großartigen Klassikern wie „Melancholia“ oder „Nymphomaniac“ durchaus sinnig ist und den Filmen eine weitere Ebene verleiht, in „The House that Jack built“ aber unfokussiert und verbraucht wirkt.
Doch es gibt natürlich auch erfreuliche Aspekte: Visuell bietet der Film vereinzelt interessante Bilder, manche stilistische Mittel erweitern die Geschichte des Films und ab und an funktioniert der krude Humor tatsächlich. Ebenfalls ist das Finale, wenn auch zu lang, fulminant und ausdrucksstark.
„The House that Jack built” will vieles sein: Eine gesellschaftliche Satire, eine absurde Komödie, eine biografische Erklärung des Regisseurs, eine Abhandlung über Kunst, eine Geschichte des Scheiterns, eine Anlehnung an literarische Klassiker, eine Kritik an Moral und Ethik. Doch wo der Film in Quantität überzeugt, versagt er in Qualität. Keiner der Punkte wird wirklich schlüssig zu Ende gedacht. Dafür werden auf Biegen und Brechen Tabus gebrochen.
Lars von Trier hat ein persönliches Manifest verfasst. Er ist der Protagonist und erklärt sich durch ihn selbst. Die Mordlust des Protagonisten steht analog zur Kunstschaffung des Regisseurs. Dadurch zeigt sich vor allem eins: Von Trier ist kein komplexer Künstler, sondern eher ein Provokateur, den das Böse fasziniert und der auf Teufel komm raus schockieren will. Die Gewalt verkommt zum Selbstzweck, die Kunst ist nicht innovativ.
Das Selbstverständnis eines Lars von Triers gleicht somit nicht einem Kubrick, einem Noé oder einem Truffaut, sondern eher einem Jugendlichen, der heimlich im Klassenraum Hakenkreuze in den Tisch ritzt. Der Regisseur erklärt und entmystifiziert sich, doch hinter der Fassade ist nicht viel Bemerkenswertes. „The House that Jack built“ ist mit Sicherheit von Triers schlechtester Film, ein absurdes Drama zum Vergessen. Jack ist Ingenieur, doch er sieht sich als Architekt. Er fühlt sich als Künstler, obwohl er nur ein gewissenloser Mörder ist. Und Lars von Trier empfindet sein Werk als kontroverse Sensation, obwohl es doch eher einem stumpfen Tabubrechen gleicht.
Der Artikel spiegelt die Ansichten des Autors wieder (Anm. d. Red.)